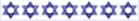Wer sind wir?
Forenregeln
Links/Tipps
Urheberrecht
Gästebuch
Wo ist die Liebe geblieben?
Was hat man mit der Liebe gemacht?
Wird Liebe leben überhaupt noch verstanden?
Die Liebe ist traurig, wurde weggeworfen - braucht man nicht mehr.
Die Liebe fragt, schreit nach:
Anstand, wo bist du?
Ehrlichkeit, wo bist du?
Achtsamkeit, wo bist du?
Höflichkeit, wo bist du?
Freundlichkeit, wo bist du?
Rücksichtnahme, wo bist du?
Gehorsam, wo bist du?
Vertrauen, wo bist du?
Helft der Liebe wieder ihren Urstand zu finden und lernen wieder Liebe zu leben!
Darf gerne geteilt werden...von ABA Gestern um 22:00
» NAHOST-Ticker
von ABA Do 21 Nov 2024, 19:45
» ISRAEL ohne KRIEG – gemeinsam in FRIEDEN leben
von JOELA Fr 15 Nov 2024, 18:00
» TRUMP und ISRAEL -Comeback des Esel Gottes- +Zwei-Staaten-Lösung?!?
von ABA Do 07 Nov 2024, 15:00
» Jerusalem - ISRAEL + Gaza gehört uns »jüdischen NAZIS«
von ABA Di 05 Nov 2024, 11:00
» TODSÜNDEN der Menschheit
von Asarja Fr 01 Nov 2024, 11:11
» Hisbollah+HAMAS Vernichtung
von ABA Do 24 Okt 2024, 14:00
» Sukkotfeste
von JOELA So 20 Okt 2024, 19:00
» الخلافة ألمانيا KALIFAT-Germania
von ABA Mi 16 Okt 2024, 00:00
» יוֹם כִּפּוּר
von ABA So 13 Okt 2024, 11:00
Keine
Der Rekord liegt bei 575 Benutzern am Di 05 Dez 2023, 20:43
Animalisches Inferno
 Animalisches Inferno
Animalisches Inferno
Animalisches Inferno
Von Bethge, Philip; Blech, Jörg; Dworschak, Manfred; Stampf, Olaf; Stockinger, Günther; Thimm, KatjaWas fühlen Rinder, Schweine und Hühner? Massentötungen und das Elend in den Agrarfabriken haben eine Debatte über den Umgang mit dem lieben Vieh entfacht. Neue Entdeckungen von Zoologen zeigen: Das Seelenleben der Tiere ist komplexer als bislang angenommen.
Die Vollstrecker keulten bis zum Sonnenaufgang. Eine Kuh nach der anderen wurde beruhigt, mit einem Strick angebunden und dann abgespritzt. Ein Amtstierarzt jagte dem jeweiligen Rindvieh eine schnapsglasvolle Giftdosis in die Venen. Sieben Sekunden später sackte das Tier stöhnend in sich zusammen.
Am Ende der nasskalten Februarnacht hatte der Tötungstrupp einen Kadaverberg aus über tausend Rindern aufgetürmt. Aufgebrachte Bürger riefen, von Polizisten nur mühsam zurückgehalten, "Mörder! Mörder!", Steine flogen. Allein Pastorin Annette-Christine Lenk, 40, leistete den Männern im Schlachthof Beistand. "Manche gingen nach draußen, wenn sie nicht mehr konnten, und weinten", erzählt sie. "Das war mein schlimmster Einsatz in 14 Jahren Seelsorge."
Wie eine Naturkatastrophe brach der Rinderwahn BSE Anfang des Jahres über das 7000-Seelen-Dorf Mücheln in Sachsen-Anhalt herein. In der "Landwirtschaftlichen Produktions- und Vertriebsgesellschaft Mücheln" (LPVG) war eine vier Jahre alte Kuh (Ohrmarke: 14 952) jählings zum Gerippe abgemagert und musste schließlich eingeschläfert werden. Dann kam das schockierende Testergebnis: Sie war BSEpositiv. Sofort ordnete der Landrat die Keulung aller übrigen Rinder an.
LPVG-Geschäftsführer Fritz Arlet konnte das Abschlachten seiner Tiere nicht mit ansehen: "Das hätte ich nicht verkraftet." Stumm wartete er bei seinen Milchkühen im Stall, die von Stunde zu Stunde immer weniger wurden. Arlet ist überzeugt, dass die Rindviecher spürten, was mit ihren Artgenossen geschah. "Normalerweise hört man immer aus irgendeiner Ecke eine Kuh muhen", erzählt er. "Doch nun plötzlich herrschte eine unheimliche Stille im Stall."
Dass mehr als tausend gesunde Kühe sterben mussten, weil unter ihnen ein einzelnes BSE-krankes Tier lebte, hat bei Tierfreunden für Wut, Trauer und Empörung gesorgt. LPG-Chef Arlet hat bis heute über 60 "Beileidsschreiben" und "Trauerbriefe" erhalten, die meisten von "fremden Menschen aus dem Westen".
Das Gemetzel in Mücheln bot einen Vorgeschmack auf die noch umstritteneren Keulungen, die in nächster Zeit zu erwarten sind. So wird es wohl auch in Deutschland bei einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) zu Massentötungen kommen. Um das animalische Inferno noch abzuwenden, fordert eine große Koalition aus Bauernvertretern, Tierschützern und Landes-Agrarministern die sofortige Notimpfung der gefährdeten Tiere. Doch die EU sperrt sich - aus handelspolitischen Erwägungen: Das Fleisch geimpfter Tiere (das vom Fleisch kranker Tiere nicht unterscheidbar wäre) könnte nicht mehr in die USA oder nach Kanada exportiert werden.
Und trotz wochenlanger Bauern-Demonstrationen ("Keine Todesstrafe für Unschuldige") beginnt von dieser Woche an, auch aus rein ökonomischen Gründen, eine weitere Vernichtungsaktion: Bis En-de Juni sollen in Deutschland mindestens 100 000 gesunde Tiere zu Tiermehl verarbeitet und in Kraftwerken verbrannt werden. Mit dieser Aktion soll das Rindfleisch wieder knapper und teurer gemacht werden - obwohl es durch die aktuellen Import- und Transportverbote ohnehin um rund 20 Prozent im Preis gestiegen ist.
"Gotteslästerung" nennt Karl Ludwig Kohlwage, evangelischer Bischof in Lübeck, die geplanten Massenschlachtungen. Der Deutsche Tierschutzbund hat bereits Strafanzeige gegen die Agrarministerin Renate Künast gestellt. Begründung: Nach Paragraf 1 des Tierschutzgesetzes dürften Wirbeltiere nicht "ohne vernünftigen Grund" getötet werden. Tierschutzpräsident Wolfgang Apel: "Man kann doch ein Mitgeschöpf nicht wie ein Altauto ausrangieren."
Mit ihrem Widerstand gegen die Tötung gesunder Rinder, Schweine und Schafe haben die Tierschützer, wie alle Umfragen belegen, eine große Mehrheit der Deutschen hinter sich. Schon seit Wochen wird das Berliner Agrarministerium mit Beschimpfungen per Brief oder Telefon bombardiert: "Schlachtet lieber die Politiker!"
Die Keulungen aus rein wirtschaftlichen Gründen haben, wie es scheint, ein lange verdrängtes Tabuthema an die Oberfläche gespült: Wie behandeln wir das liebe Vieh? "Bei vielen Deutschen regt sich auf einmal das schlechte Gewissen", sagt Apel, "weil ihnen bewusst wird, dass wir die Tiere zu bloßen Warenobjekten gemacht haben."
Bisher wollten die meisten Konsumenten lieber gar nicht so genau wissen, unter welchen Bedingungen ihre Steaks und Frühstückseier produziert werden. Auch ohne BSE und MKS landen bereits Millionen von Nutztieren statt auf dem Teller als Fleischabfall auf dem Müll:
* Von rund 44 Millionen jährlich für den Verzehr aufgezogenen Schweinen müssen über eine Million ungenutzt weggeworfen werden, weil sie den Schlachthof gar nicht erst lebend erreichen. Die meisten Borstentiere verbringen ihr Leben in halbdunklen Ställen - und wenn sie am Schlachttag zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken, erleiden viele von ihnen einen Herzinfarkt.
* Jährlich 43 Millionen Legehennen werden in überbesetzten Drahtverhauen zerschlissen, wo die Vögel nicht einmal mit den Flügeln schlagen können. Die meisten vegetieren auf einer Fläche, die kleiner ist als eine Druckseite im SPIEGEL - obwohl das Bundesverfassungsgericht solche lebenslangen Knäste vor zwei Jahren für verfassungswidrig erklärt hat.
* 250 Millionen Rinder, Schweine, Pferde und Schafe werden jedes Jahr innerhalb von Europa transportiert - viele von ihnen bis zu 20 Stunden ohne Auslauf, ohne Wasser. Jedes zehnte Tier kommt tot am Zielort an.
Wenig Grund zur Freude haben oft auch die Versuchstiere, die ihr Leben für die Forschung lassen. Allein 1999 wurden in den Labors 1,6 Millionen Hunde, Katzen, Affen, Ratten und Mäuse zerschnippelt, vergiftet oder infiziert - fast 60 000 mehr als noch im Jahr zuvor.
Zwar haben alternative Testmethoden in der Pharmaindustrie einen Rückgang der Tierexperimente bewirkt. Doch dafür hat der "Verbrauch" an Tieren in der zweckfreien Grundlagenforschung stark zugenommen - vor allem durch den Aufschwung der Gentechnik. Die Kehrseite des Bio-Booms sind Experimente, die zuweilen an Grausamkeiten eines mittelalterlichen Folterkellers gemahnen: Immer wieder entstehen genetische Krüppel, die kaum den anderen Morgen erleben.
An der Tierärztlichen Hochschule Hannover steckte ein junger Doktorand vergangenes Jahr schwangere Beagles-Hündinnen mit Spulwurmeiern an - um ganz gezielt deren Junge noch im Mutterleib zu infizieren. An den possierlichen Hunden mit den traurigen Augen sollte auf diese Weise ein neues Medikament gegen Parasitenbefall getestet werden. Doch nicht jedes Tier bekam die Arznei: Mehr als 20 Welpen hatten bei ihrer Geburt blutigen Durchfall; Eiter ronn aus der Nase. Nach sechs Wochen fand der Spuk ein Ende - alle Hundebabys wurden getötet.
"Erst unter dem Druck der grausamen Bilder von torkelnden, verbrannten, zu Abfall reduzierten Kühen regt sich eine neue Sensibilisierung", hat Philosoph Peter Sloterdijk erkannt. Auf einmal betrachte das Volk die Versuchslabors und "Konzentrationsställe" mit neuen Augen: "Man versteht wieder, dass ganz dicht unter der normalisierten Oberfläche das Grauen und die Infamie weiterhin präsent sind."
Aber was kriegen Tiere wirklich mit von der Barbarei, die sie in Ställen, Viehtransportern, Genlabors oder Käfigen der Arzneimittelforscher erdulden müssen? Haben Hunde, Pferde und Schweine womöglich eine komplexere Gefühls- oder gar Gedankenwelt als bislang angenommen? Wie sehr ähneln die Tiere dem Menschen?
Über all diese Fragen streiten sich die Wissenschaftler seit langem. Immerhin haben sich Biologen inzwischen weit von dem französischen Naturforscher René Descartes (1596 bis 1650) entfernt, dessen Ideen jahrhundertelang das Tierbild der Wissenschaft prägten: Descartes hatte das vernunftbegabte Wesen Mensch ("Ich denke, also bin ich") in einem theoretischen Gewaltakt rigoros von der übrigen Natur getrennt. Allein seinesgleichen gestand der Denker eine empfindungsfähige Seele zu; Tiere beschrieb er als fühllose, wenn auch bewunderswert kompliziert gebaute Reflexautomaten.
Vor allem in den letzten Jahren gelangen Verhaltensforschern erstaunliche Entdeckungen, die das Bild von seelenlosen und strohdummen Bio-Maschinen fast völlig zum Einsturz gebracht haben: Ratten lernen, vergiftete Köder zu erkennen, und geben dieses Wissen sogar an nachfolgende Generationen weiter; Elefanten scheinen tatsächlich um ihre toten Artgenossen zu trauern; Rhesusaffen bestehen Mathematiktests, an denen einjährige Kinder noch scheitern würden - Tiere, allen voran Primaten, verfügen offenbar über Fähigkeiten, die ihnen bis vor kurzem noch kaum jemand zugetraut hätte.
"Es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass Menschenaffen mindestens so intelligent sind wie vierjährige Kinder", sagt der neuseeländische Biologe David Penny. Beweise für seine weit reichende Deutung der Experimente stehen indes noch aus.
Das Hauptproblem der Verhaltensforscher: Tiere können nicht mit den Menschen sprechen. Aus dieser Sprachlosigkeit jedoch abzuleiten, Hund, Katze, Maus seien bloße Bio-Roboter, die wie Uhrwerke ihren Instinktprogrammen folgen, wäre voreilig. "Wenn Tiere reden könnten", glaubt der deutsche Tierschutzpräsident Apel, "müssten wir uns eine bittere Abrechnung anhören."
Schon einmal haben Mediziner einen verhängnisvollen Irrtum begangen: Auch Säuglinge und Kleinkinder mussten bis vor kurzem unnötig leiden - nur, weil sie sich nicht artikulieren können. So glaubten Mediziner lange Zeit, das Schmerzempfinden sei in der frühen Lebensphase noch nicht funktionsfähig. Bis Ende der achtziger Jahre setzten Kinderchirurgen deshalb bei den meisten Operationen zu wenig Betäubungsmittel ein.
Doch dann fanden Forscher heraus, dass Säuglinge sehr wohl bereits über ein ausgeprägtes Schmerzempfinden verfügen. Für die Malträtierten hat die frühe Fehlbehandlung oft lebenslange Konsequenzen: Sie leiden unter einer herabgesetzten Schmerzschwelle. Schon einfache Berührungen können für sie sehr unangenehm sein.
Haben die Wissenschaftler bislang auch das Leiden der Lämmer unterschätzt? Muss den Tieren eine vergleichbare Leidensfähigkeit zugestanden werden wie den Menschen? Spüren Rinder und Schweine womöglich, was sie hinter den Schlachtmauern erwartet? Haben sie gar eine Ahnung vom Tod?
"Gerade Schweine und Rinder sind sehr schlaue und gefühlsbetonte Geschöpfe", erklärt Marc Bekoff, 55, der an der University of Colorado in Boulder seit 30 Jahren das Verhalten der Tiere erforscht.
Die Massentötungen in Europa schockieren den Wissenschaftler, der im Lauf seiner Arbeit zum Vegetarier geworden ist. "Die Tiere spüren den Schmerz doppelt. Einerseits, wenn sie mitbekommen, wie ihre Artgenossen getötet werden. Andererseits, wenn sie selbst dran glauben müssen. Viele Menschen werden sich jetzt fragen, ob sie jemals wieder Fleisch essen sollten."
Ein schweres Unbehagen weht allmählich, wie es scheint, selbst hartnäckige Fleischfreunde an. In der langen Geschichte des Schlachtens ist das ein neues Phänomen. Bis ins 19. Jahrhundert war das Niedermachen von Mitgeschöpfen nichts Besonderes; die Tiere verröchelten meist vor aller Augen.
Im Mittelalter schlachteten die Metzger ungescheut im Freien oder in öffentlichen Schlachtbuden und Fleischbänken, durchaus auch zum Ergötzen des Volks. Zartere Seelen klagten bis in die neuere Zeit über die Gefühllosigkeit, mit der die Tiertöter zu Werke gingen.
Der Stuttgarter Pfarrer Christian Adam berichtete 1833 von vielerlei Gräueln aus "sündhafter Thorheit" dem Tier gegenüber. Einmal schrecken ihn während einer Wanderung "furchtbare Schmerzensschreie" auf. Vor einem Gasthaus macht sich gerade der Dorfschlächter mit seinem Lehrbuben über ein Schwein und ein Kalb her: "Der Metzgerjunge bohrt seine Finger in die Augen der Schlachtopfer, damit sie schreien und dem Dorf dadurch verkünden, dass hier geschlachtet und Fleisch die Hülle und Fülle zu haben sein wird."
Das Leiden der Tiere brachte kaum jemanden um den Schlaf. Oft genug hatten die Leute ihr Vergnügen daran - und das nicht nur in den Stierkampfarenen Spaniens. In Frankreich war über Jahrhunderte der Brauch beliebt, am 24. Juni Katzen bei lebendigem Leib ins Johannisfeuer zu werfen.
Was Tiere tatsächlich empfinden, wenn sie getötet werden, ist auch heute noch schwer zu ermitteln. Als gesichert gilt, dass der gewaltsame Tod, der sie in freier Wildbahn ereilt, weitgehend schmerzlos erfolgt. Ein Gnu, das von einem Krokodil zerrissen wird, spürt wohl kaum etwas. Sein Organismus schüttet beim ersten Entsetzen eine Dosis schmerzstillender Endorphine aus.
Dass der Körper in plötzlicher Todesgefahr Schmerz unterdrücken kann, ist eine sinnvolle Errungenschaft der Evolution:
Selbst verwundeten Beutetieren bleibt so noch eine Chance zur Flucht. Auch eine Maus, die in die Fänge einer spielenden Katze gerät, muss deshalb während der langen Quälerei bis zum Ende kaum Schmerzen erleiden.
Doch im hoch industrialisierten Schlachthof ist alles anders: Die Tiere verbringen Stunden in einer fremden, verängstigenden Umgebung voller Gerüche, Lärm und Gerempel. Der Tod kommt so langsam, dass ihnen sein Schrecken nicht erspart bleibt.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden die Tiere in den Schlachthöfen immerhin vor dem Töten betäubt - schon damit sie den Fortgang der blutigen Handlung nicht stören. Nur mit stillgestellten Tierkörpern funktioniert das industrielle Massenmetzgern nahezu reibungslos, das in den Schlachthöfen von Chicago seinen Ausgang nahm.
Dort sah einst der junge Automobilbauer Henry Ford mit Staunen, wie eine endlose Prozession von Schweinen und Rindern, kopfüber an einer Laufkette aufgehängt, an den Arbeitern vorüberschaukelte. Jeder Mann tat der Reihe nach seinen bestimmten Handgriff, Schnitt oder Beilhieb. Das Tier durchlief die Maschinerie nur noch als Rohstoff, aus dem das Schlachthaus Waren erzeugte. Ford bekannte später in seinen Erinnerungen, erst die Schlachthöfe hätten ihn auf die Idee des Fließbands gebracht.
Eben diese mechanische Gleichgültigkeit des Tötens erregt heute die Gemüter. Kritiker bezweifeln, dass die Tiere überhaupt anständig betäubt werden.
Von Hühnern ist schon länger bekannt, dass viele noch bei Bewusstsein sind, wenn sie ins Messerwerk geraten. Forscher von der Tierärztlichen Hochschule Hannover haben jetzt herausgefunden, dass auch Schweine häufig nicht schmerzfrei sterben. Die Veterinäre fanden bei fast der Hälfte der geschlachteten Tiere Muskelblutungen oder Knochenbrüche. Ein deutliches Indiz dafür, sagt der Tiermediziner Jörg Hartung, "dass die Betäubung nicht angemessen war".
Schweine werden meist mit einer Elektrozange betäubt, die ihnen einen Stromschlag versetzt. Ist der Schlag zu stark, reißen die Muskelfasern, Blut sickert ins Gewebe - und die Fleischqualität sinkt. Die Schlachthöfe dosieren die Stromspannung deshalb lieber niedrig. Wenn dann aber auch noch die Zange nicht genau an den Schläfen ansetzt, ist der Stromschlag zu schwach: Das Tier bricht bestenfalls gelähmt zusammen, bleibt aber bei Bewusstsein. "Viele Tiere", sagt Hartung, "zeigen sogar beim Ausbluten am Haken noch Schmerzreaktionen." Das heißt, sie sind noch empfindungsfähig.
Die Veterinäre aus Hannover haben erforscht, wie man den Tieren ihren letzten Gang erleichtern könnte. Schweine bekommen zum Beispiel auf den letzten Metern ihres Laufgangs oft Herzrasen - offenbar nicht, weil sie die Lage begreifen, sondern weil sie plötzlich allein sind. Ein Spiegel am Ende des Gangs wirkt da Wunder: Das Schwein sieht sich einem Artgenossen gegenüber und bleibt ruhig.
Am wichtigsten ist, dass die Tiere auf dem ganzen Weg, angefangen in ihrem Stall beim Beladen des Transporters, nicht aus der Ruhe geraten. "Das heißt: nicht herumschreien, nicht schlagen, Zeit lassen", empfiehlt Tiermediziner Hartung. "Das lohnt sich auch für den Verbraucher", fügt er hinzu. "Fleisch von Schlachttieren, die in Panik gestorben sind, wird leicht grau und wässrig. Die Zellen lösen sich vorzeitig auf."
So lange keine Hetze aufkommt, lassen die Tiere fast alles mit sich geschehen. Ihren Tod wittern sie wohl nicht, vermutet Veterinär Martin von Wenzlawowicz, der Schlachthöfe im humanen Umgang mit ihren Opfern berät. Es kommt vor, erzählt der Forscher, dass Schweine in kleinen Gruppen nacheinander mit Stromschlägen getötet werden. Wenn das ohne Geschrei vonstatten geht, laufen die noch lebenden Tiere seelenruhig herum, schnüffeln neugierig an den toten Artgenossen und lecken deren Blut auf. Schlachttiere, ist sich Wenzlawowicz sicher, haben keinerlei Vorstellung von der Endlichkeit ihres Lebens.
Gegen diese Vermutung spricht, wie manche Tiere in freier Wildbahn reagieren, wenn ein nahe stehender Artgenosse stirbt. Graugänse bleiben nach dem Verlust des Lebenspartners mitunter jahrelang allein und zeigen alle Symptome einer Depression. Seelöwinnen heulen schauerlich, wenn ihr Kleines von einem Orca geraubt wird. Affenmütter suchen tagelang nach Jungtieren, die ihnen abhanden gekommen sind.
Wenn ein Äffchen aber in Obhut seiner Mutter stirbt, geschieht oft etwas Wunderliches: Die Mutter trägt ihr totes Kind wie eine Puppe tagein, tagaus mit sich herum, untersucht gelegentlich Haut und Haare, laust es und schleppt es weiter. So geht das dahin, als wäre das Kind noch am Leben, bis der kleine Körper mit der Zeit in Verwesung übergeht und schließlich austrocknet. Am Ende fällt vielleicht ein Arm ab, dann ein Bein - erst dann ist die Mutter langsam in der Lage, die Überreste aufzugeben und zu vergessen.
Heißt das, wie manche Forscher vermuten, die Äffin sei wahnsinnig geworden vor Trauer? Oder hat sie einfach nicht kapiert, was geschehen ist? Waltete hier nur eine blinde Bindung an ein Objekt, das den richtigen Geruch hatte?
Den stärksten Anschein von Mitgefühl können Elefanten erwecken. Verhaltensforscher beobachten häufig ganze Herden, wie sie sich etwa um ein tot geborenes Baby versammeln. Gelegentlich stupsen sie den Kadaver mit ihren Rüsseln und versuchen, ihn zum Aufstehen zu bewegen. Dann stehen sie tagelang, die Köpfe gesenkt und mit hängenden Ohren, wie eine Trauergemeinde.
Elefanten können sogar weinen. Eine Drüse an der Innenseite der Augenhöhle gibt ein Sekret ab, das wie eine Träne über das Gesicht kullern kann.
In den sechs Kilogramm schweren Gehirnen der grauen Riesen entstehen offenbar Gefühle, die sie zu den sozialsten Geschöpfen der Erde machen: Bullen und Weibchen winden ihre Rüssel verliebt ineinander. Wird ein Elefantenbaby geboren, eilen Tanten und Geschwister herbei und betasten es. Das Kleine darf nicht nur bei seiner Mutter, sondern auch bei allen anderen Müttern Milch saugen.
Und wenn ein Elefant erkrankt oder durch die Kugel eines Wilderers verwundet wird, dann pflegen ihn seine Verwandten. Mit dem Rüssel streicheln sie den Maladen. Auf offene Wunden schmieren sie eine Art Pflaster aus Lehm. Zudem haben Biologen häufig beobachtet, wie Elefanten einen angeschlagenen Artgenossen stützen oder ihm auf die Beine zu helfen versuchen.
Die in Kenia geborene Zoologin Joyce Poole studiert seit einem Vierteljahrhundert das Verhalten frei lebender Dickhäuter. Deren Gefühle, sagt sie, ließen sich am besten mit Begriffen wie "Freude, Glück, Liebe, Freundschaft, Überschwang, Leidenschaft und Achtung" charakterisieren.
Doch selbst simpel anmutenden Kreaturen wie Fischen, Echsen oder Mäusen gestehen Forscher seit kurzem zu, weit mehr zu sein als seelenlose Automaten. "Wir erleben gegenwärtig eine Revolution im Tierbild", konstatiert der Verhaltensbiologe Norbert Sachser, der an der Universität Münster das Befinden vieler Tierarten, von Meerschweinchen bis hin zu Nashörnern, untersucht. Es gebe keinen Zweifel mehr, dass "alle höheren Wirbeltiere Emotionen spüren".
Manche Gorillababys verschmerzen den Tod ihrer Mutter nicht. "Erst erlischt das Leuchten in ihren Augen, und dann sterben sie einfach", erzählt Judy McConnery. Für das Projekt "Protection des Gorilles" pflegt sie im zentralafrikanischen Regenwald kleine Gorillas, deren Mütter von Wilderern getötet wurden.
"Der emotionale Zustand vieler Tiere ist leicht zu erkennen. Ihre Gesichter, ihre Augen und die Art, wie sie sich verhalten, geben uns starke Hinweise, wie sie sich fühlen", sagt auch Marc Bekoff von der University of Colorado in Boulder, der entsprechende Hinweise von 50 namhaften Zoologen in einem kürzlich erschienenen Buch zusammengetragen hat*.
Der deutsche Zoologe Bernd Würsig beschreibt darin beispielsweise das Liebesleben der Glattwale, das er vor der Küste Argentiniens beobachten konnte: Nachdem das Männchen mit seinem rosafarbenen Penis in das Weibchen eingedrungen war, kuschelte das Paar noch ein Weilchen an der Meeresoberfläche. Die zwei Kolosse dümpelten nebeneinander, tätschelten einander mit den Flossen und umarmten sich, ehe sie - Flosse an Flosse - in die Tiefe tauchten. Würsig glaubt: "Die beiden waren verknallt ineinander und waren be-
stimmt noch voller Wonne, als sie fortschwammen."
Nicht nur Liebe und Trauer, sondern auch Anzeichen schierer Lebenslust haben Zoologen im Reich der Tiere erspäht: Im Regenwald von Sumatra baumeln Orang-Utans kopfüber an Ästen und planschen mit den Händen im Wasser. In den walisischen Bergen legen sich Raben auf den Rücken und rodeln immer wieder schneebedeckte Hänge hinunter. Ähnliche Freuden kennen die Büffel Nordamerikas: Laut grunzend schlittern sie über vereiste Flächen. Und auf der japanischen Insel Honshu spielen junge Makakenaffen mit selbst geformten Schneebällen.
Zwar lernen junge Tiere beim Spielen vor allem Fertigkeiten, die sie für ihr Überleben brauchen. Doch Bekoff zufolge geht es - wie beim Menschenkind - auch um Spaß: "Spielende Tiere sind Symbole für die reine Freude am Leben."
Liebestolle Wale? Rodelnde Raben? So anrührend die Berichte klingen, sie sind mit Vorsicht zu deuten. Nur zu gern sehen Menschen im Tier menschliche Züge. "Jede Vermenschlichung von Tieren führt aber in die falsche Richtung", warnt der Berliner Verhaltensbiologe Rainer Struwe.
Was ist zum Beispiel von jener Lebensrettungsaktion zu halten, die das Gorillaweibchen Binti Jua im Zoo von Brookfield (US-Bundesstaat Illinois) vollbracht hat? Im August 1996 war ein drei Jahre altes Menschenkind sechs Meter tief in das Gehege gestürzt. Was dann geschah, hielt ein Zoobesucher mit seiner Videokamera fest: Binti Jua schützte den lebensbedrohlich am Kopf verletzten Jungen vor den sechs anderen Gorillas und trug ihn vorsichtig zu einer Eingangstür, wo Wärter ihn erreichen konnten. Binti, die bei ihrem Tun ihr eigenes Junges auf dem Rücken trug, wurde als selbstlose Retterin gefeiert.
Doch ahnte die Äffin überhaupt, was sie tat? "Einen Teddybär oder eine Tüte Kartoffelchips" hätte sie womöglich ebenso
fürsorglich behandelt, spekuliert der Verhaltensforscher Marc Hauser von der Harvard University im amerikanischen Cambridge. In einem soeben erschienenen Buch über das Seelenleben der Tiere schildert er das Dilemma der Forschung: Zwar mangele es nicht an Anekdoten über animalische Befindlichkeiten; die meisten davon ließen sich bisher jedoch nicht mit dem Maßstab strenger Wissenschaft erhärten**.
Das gilt besonders für die ungezählten Legenden, die sich um den Haushund ranken, der vermenschlicht wird wie kein zweites Geschöpf. "Natürlich sind Hundebesitzer davon überzeugt, dass ihre Tiere genau mitbekommen, was Herrchen denkt", sagt Josef Call vom Max-Planck- Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Die Geschichten von trauernden, liebenden, glücklichen oder beleidigten Hunden seien wissenschaftlich jedoch bisher weitgehend unbrauchbar. Wie Hunde wirklich ticken, sagt Call, "darüber wissen wir noch sehr wenig".
Seit kurzem versuchen die Leipziger Forscher, genauere Einblicke in das Verhalten des Vierbeiners zu gewinnen. Fünf Monate lang untersuchten sie, ob sich "stinknormale Haushunde" (Call) von der Anwesenheit eines Menschen beeinflussen lassen: In einem den Hunden unbekannten Raum hatte die Mitarbeiterin Juliane Kaminski Hundekuchen auf den Boden gelegt. Dann verbot sie dem jeweiligen Vierbeiner, davon zu naschen - und verließ das Zimmer. Achtmal führten die Forscher jeden Hund in Versuchung - und es dauerte, so zeigen die Videoaufnahmen, jedes Mal höchstens fünf Sekunden, bis sie schwach wurden.
Bei einer zweiten Versuchsanordnung blieb die Wissenschaftlerin nach dem Fressverbot im Raum, gab sich allerdings unterschiedlich aufmerksam: Entweder spielte sie mit einem Gameboy herum, saß mit geschlossenen Augen auf ihrem Stuhl, kehrte dem Hund den Rücken zu oder sah ihn unentwegt an.
Das Ergebnis der Versuche erinnert an ein Experiment mit kleinen Kindern und Schokolade: Schien der Mensch abgelenkt, langten die Hunde zu. Allein der Blickkontakt hinderte die meisten am Futterklau. "Drehte der Mensch ihnen aber den Rücken zu, liefen die meisten schnurstracks auf den Keks zu", berichtet Kaminski.
Wähnten sie sich hingegen beobachtet, schlichen sich die Hunde in weitem Bogen an das Futter heran. Immer wieder blickten sie dabei zum Menschen, als wollten sie taxieren, ob der sie kontrolliert. Außerdem verdeckten sie noch das Futter mit ihrem Körper, als solle es aus dem Blickfeld des Menschen verschwinden.
Dass Hunde dem Blick des Menschen folgen und ihn sogar lesen können, erklärt Versuchsleiter Call auch mit einer geradezu menschlichen Fähigkeit: "Es könnte sein, dass Hunde im Laufe der Domestikation gelernt haben, sich wie Babys zu verhalten. Sie versuchen, durch Augenkontakt die Reaktionen des dominanten Menschen zu ergründen."
Der englische Biochemiker Rupert Sheldrake traut Hunden und anderen Haustieren sogar Übermenschliches zu: Telepathie. In seinen Schriften berichtet der Gelehrte von Hunden, die angeblich auf die Stunde genau voraussehen, wann ihre Herrchen aus dem Urlaub nach Hause kommen; von Katzen, die zum läutenden Telefon springen, weil sie erahnen, wer am anderen Ende der Leitung ist; und von Vögeln, die zwei Tage vor Ferienbeginn immerzu den Namen des Sohnes plappern, der aus dem Internat anreisen wird.
Dass die Wissenschaftszeitschrift "Nature" unlängst dazu aufrief, Sheldrakes Bücher zu verbrennen, ficht ihn nicht an: Das Publikum liebt ihn. Sein Werk "Der siebte Sinn der Tiere" wurde zum internationalen Bestseller - als Bestätigung für all jene, die selber Ungewöhnliches von ihrem Haustier zu berichten wissen.
Zu dieser großen Schar zählen auch Hobbyforscher wie die Düsseldorfer Oberstudienrätin Karla Baumann. Sie ließ sich aus Metall Imitate von Pferdeohren fertigen, die sie an einem Stirnband trägt. Mit diesen beweglichen Ohrenattrappen, so Baumann, könne sie in der "Ohrensprache" Kontakt zu Pferden aufnehmen. Verhaltensbiologe Norbert Sachser von der Universität Münster hält die Pferdeohrenattrappen für Humbug: In einem Forschungsprojekt, das zwei Jahre dauerte, konnte er keinen Einfluss der Ohren auf die Verständigung zwischen Ross und Reiter feststellen.
Ungeachtet solcher Kuriositäten der Verhaltensforschung sammeln auch Biochemiker zunehmend Hinweise auf das Gefühlsleben von Tieren. Die Forscher haben in jüngster Zeit herausgefunden, welche biochemischen Botenstoffe hinter bestimmten Empfindungen stecken. Und sie haben festgestellt, dass in Buntbarschen, die aufgebracht ihr Revier verteidigen, die gleichen Hirnregionen aktiv sind wie bei wütenden Menschen.
In den Gehirnen spielender Ratten wiederum fand der amerikanische Neurowissenschaftler Steven Siviy große Mengen von Dopamin, einem Botenstoff, der auch bei Menschen Wohlbefinden auslöst. Als Siviy seinen Ratten eine Arznei verabreichte, die den Effekt des Dopamins blockiert, war es bei den Tieren mit der Spielfreude vorbei.
Genau wie Menschenbabys profitieren auch Rattenjunge ein Leben lang davon, wenn sie nach ihrer Geburt besonders viel Fürsorge erfahren haben. Kleine Nager, die von ihren Müttern besonders häufig und aufmerksam abgeschleckt werden, entwickeln in ihren Hirnzellen eine besonders hohe Zahl bestimmter Rezeptoren - was sie furchtloser macht. Zudem schütten sie weniger Stresshormone aus. Diese Unterschiede erklären, warum die umhegten Ratten sich im Erwachsenenalter besonders ruhig und gelassen verhalten.
Trotz aller verblüffenden Befunde, die weit reichende Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier nahe legen, bezweifeln Experten wie der Tierpsychologe Clive Wynne von der University of Western Australia in Perth, dass Hunde und Katzen wirklich Regungen verspüren, die menschlichen Gefühlen ähneln. "Wir sind auf diesem Planeten mitnichten von dinghaften Personen in Fell und Federkleid umgeben, sondern von Myriaden von Geschöpfen, die alle ein ganz einzigartiges Seelenleben haben", konstatiert Wynne. Man solle endlich aufhören, Tiere "als tumbere Kopien von uns selbst zu verstehen".
Besonders Primatenforscher wollen sich mit diesem Verdikt jedoch nicht abfinden. Tatsächlich zeigen Menschenaffen Hirnleistungen, die allenfalls noch einen graduellen Unterschied zum Homo sapiens erkennen lassen. Einige Schimpansen haben sogar eine Zeichensprache mit rund hundert Wörtern erlernt.
Und selbst das Ich-Bewusstsein, das Erkennen der eigenen Identität, scheint nicht dem Menschen vorbehalten. In einem berühmt gewordenen Versuch hat der amerikanische Verhaltensforscher Gordon Gallup Schimpansen betäubt und ihnen Farbmarken auf die Stirne aufgetragen. Nach dem Erwachen reagierten die Tiere zunächst nicht auf die Veränderung. Sobald sie sich aber im Spiegel sahen, rieben sie sofort den Fleck von der Stirn. Gallup ist überzeugt: "Tierarten, die den Spiegeltest bestehen, sind sich ihrer selbst bewusst und können daher auf den mentalen Zustand anderer Individuen schließen."
Solche erstaunlichen Forschungsergebnisse sind es, die radikale Tierrechtler dazu veranlassen, sich den Großen Menschenaffen mit besonderem Enthusiasmus zu widmen. Organisiert im "Great Ape Project", fordern sie, zumindest Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans "Menschenrechte" zuzusprechen, um ihnen dadurch unter anderem das Recht auf Leben und auf individuelle Freiheit zu garantieren. Zu den Fürsprechern der Affen-Eingemeindung zählen die Schimpansenforscherin Jane Goodall, der britische Evolutionsforscher Richard Dawkins und der umstrittene australische Bio-Ethiker Peter Singer.
"Es wird Zeit, dass wir die Rechte derer anerkennen, die uns am nächsten stehen", verlangt Singer. Der Philosoph vergleicht den derzeitigen Status der Menschenaffen mit dem von Sklaven: Wer gegen Rassismus und Sexismus kämpfe, argumentiert Singer, müsse auch gegen den "Speziesismus" kämpfen - die Diskriminierung anderer Tierarten. Ihren ersten großen Erfolg konnte die Bewegung bereits feiern: Im Oktober 1999 räumte das neuseeländische Parlament den Großen Menschenaffen das Recht auf Leben und angemessene Unterbringung ein; auch vor Folter und medizinischen Experimenten sind die Primaten in dem Inselstaat seither sicher.
Viele gemäßigte Tierschützer können über den Gelehrtenstreit um Menschenrechte für die nahe biologische Verwandtschaft allerdings nur die Köpfe schütteln. Anstatt sich in philosophische Diskussionen über die Intelligenz einiger weniger Arten zu verwickeln, sorgen sie sich mehr um das Milliardenheer der Fleischlieferanten, deren Dasein oftmals einem nicht enden wollenden Horrortrip gleicht.
Wer sich in deutschen Ställen umsieht, stößt auf Tiere, die zu Fress- und Legemaschinen degradiert sind. Er findet Puten, deren Knochen den eigenen Körper kaum noch tragen können, und Rinder, die im Dämmerlicht ihrer Ställe von grünen Wiesen nicht einmal träumen können, weil sie noch nie eine gesehen haben.
"Alle diese Tiere leiden", bilanziert der Verhaltensforscher Detlef Fölsch von der Gesamthochschule Kassel. "Das Tierschutzgesetz, das unnötiges Leiden eigentlich verbietet, wird bei der Tierhaltung in Deutschland oft komplett ignoriert." Der Deutschen liebster Fleischlieferant zum Beispiel ist eine arme Sau: In rund 139 000 deutschen Ställen stehen heute dicht an dicht an die 26 Millionen Borstenviecher. Sind die Schweine männlichen Geschlechts, beginnt das Martyrium bereits in den ersten Lebenswochen: Bei vollem Bewusstsein wird den Ferkeln der Hodensack aufgeschnitten. Die empfindlichen Geschlechtsorgane werden aus der Bauchhöhle gedrückt, die Samenleiter mit der Zange gekappt. Der Eingriff soll den penetranten Ebergeruch verhindern, der sonst dem Verbraucher den Braten vergällt.
In den folgenden sechs Monaten ihres kurzen Lebens stehen die Tiere dann in dunklen Boxen von einem Quadratmeter Größe auf Spaltenböden aus Beton und atmen die Ausdünstungen ihres eigenen Kots ein. Eintönigkeit und Enge führen häufig zu Verhaltensstörungen, Angriffslust oder gar Kannibalismus. Damit sich die Tiere nicht gegenseitig die Schwänze abbeißen, werden diese frühzeitig gekappt, die Eckzähne abgeschliffen.
Ähnliche Verhältnisse herrschen bei der Kälbermast: Drei Quadratmeter Stallfläche sind für ein Rind derzeit vorgeschrieben. Oft fristen die Tiere in so genannter Anbindehaltung ihr trostloses Dasein. In engen Boxen festgebunden, können sie sich noch nicht einmal artgerecht hinlegen. Um Verletzungen zu vermeiden, werden den Jungtieren die Hörner aus dem Schädel gebrannt.
Und wie fühlt sich eine Legehenne in ihrem schuhkartongroßen Drahtverhau? Fast jedes zehnte Huhn geht an Krankheiten und Stress ein, noch bevor es geschlachtet werden kann. Beim Abtransport kommen oft so genannte "Hühnerfangmaschinen" zum Einsatz: überdimensionale Staubsauger, die die Tiere aus den Käfigen schlürfen und über dicke Rohrleitungen in Lastwagen blasen.
Eng zusammengepfercht sitzen auch mehr als sieben Millionen Puten und Puter in deutschen Mastanstalten ein. An ihnen zeigt sich die ganze Perversion der industriellen Tierhaltung: Hochleistungsrassen werden einseitig auf Schnellwüchsigkeit und Muskulatur gezüchtet. In nur 21 Wochen erreichen die Turbotruthähne ihr Schlachtgewicht von 20 Kilogramm. Doch weil der Brustmuskel (das beliebte Putensteak) dadurch zu schwer wird, können die Tiere kaum noch laufen. Die Kniegelenke sind häufig verformt oder entzündet, der Rücken verkrüppelt.
Damit sich die Puten nicht gegenseitig die Federn ausreißen, wird ihnen zudem schon im Kükenstadium der von zahllosen Nerven durchzogene Schnabel abgebrannt. Das ist so, sagen Tierschützer, als würde man einem Menschen die Oberlippe abschneiden.
Der Höhepunkt der Grausamkeit kommt für viele Nutztiere aber oft erst nach der Aufzucht: beim Transport in weit entfernte Schlachthäuser. Bis zu 3000 Kilometer weit werden Schlachtpferde aus Osteuropa auf so genannten Marathontransporten in die Mittelmeerländer gekarrt, um Franzosen und Italienern angeblich frisches Pferdefleisch auf den Teller zu zaubern.
Die für die Schlachtbank bestimmten Tiere drängen sich auf überladenen und schlecht belüfteten Fahrzeugen. Vom Personal werden sie mit Elektrostäben und Forken traktiert, Höchsttransportzeiten stehen nur auf dem Papier. Entlang der Elendsrouten gibt es viel zu wenige Versorgungsstationen, um den Tieren genügend Wasser und Futter zu verschaffen.
Vielen der geschundenen Kreaturen ist bei den wenigen Unterbrechungen ohnehin nicht nach Fressen zumute. Sie sind apathisch, oft haben sie gar nicht mehr die Kraft, sich an die Tränkschalen zu drängen. Andere stehen während der schwankenden Passage quer durch Europa auf drei Läufen, weil sie sich im Gedränge oder beim Auskeilen die Knochen gebrochen haben. Viele kommen zerquetscht oder mit ausgeschlagenen Augen und klaffenden Wunden am Bestimmungsort an.
Trotz solcher Grausamkeiten scheinen die Missstände bei Tierhaltung und -transport an den meisten Verbrauchern abzuperlen wie Wasser an der Butter. Neun von zehn in Deutschland verkaufte Eier stammen noch immer aus großen Legefabriken. Der Handel drückt die Fleischpreise in pervers anmutende Tiefen: Ein ganzes Brathähnchen kostet heute mit etwa drei Mark so viel wie eine Tube Zahnpasta.
Fast scheint es, als hätten viele naturentfremdete Stadtmenschen schon vergessen, dass das Schnitzel auf dem Teller von lebenden Tieren stammt und dass Tiere auch mal krank werden - was manche übertriebene Reaktionen auf die Wiederkehr der uralten Maul- und Klauenseuche erklären könnte.
Erst angesichts torkelnder Rinder und lodernder Scheiterhaufen scheint jetzt ein Umdenken einzusetzen. Aufgeschreckt von den wachsenden Bürgerprotesten, will nun auch die Politik das Tierelend in der Agrarindustrie bekämpfen. Vergangenen Mittwoch stellte das Bundeskabinett den neuesten Tierschutzbericht vor. Gleich-zeitig gab Agrarministerin Künast die künftige Marschrichtung vor.
Bis Ostern soll demnach eine neue Legehennenverordnung fertig sein. Weitere Käfiganlagen will Künast ab sofort nicht mehr genehmigen. Freilandhaltung und artgerechte Tierhaltungssysteme sollen künftig verstärkt gefördert werden. Und schließlich will die Agrarministerin die EU-Partner davon überzeugen, die Dauer von Viehtransporten künftig auf maximal vier Stunden zu begrenzen.
Eine solche Regelung wäre nicht nur ein Segen für die Tiere, sondern könnte auch die Ausbreitung von Seuchen wie MKS wesentlich verzögern. 14 Millionen Tiere werden pro Jahr kreuz und quer durch die EU gekarrt oder (sogar gefördert von EU-Exportsubventionen) in Drittländer außerhalb der Gemeinschaft transportiert. Als blinde Passagiere immer im Gepäck: die Erreger zahlloser Krankheiten. Auch die Verhältnisse in den Agrarfabriken bieten MKS, BSE und anderen Plagen einen idealen Nährboden. "Nutztiere sind auf Hochleistung gezüchtet", sagt Verhaltungsforscher Fölsch. "Ihr gesamter Stoffwechsel ist verändert, das Immunsystem geschwächt." Daher sei auch die Krankheitsanfälligkeit erhöht.
Eine Wende zum Besseren wäre gar nicht so schwer, glaubt Fölsch. Oft würden schon relativ simple Maßnahmen bei Transport und Haltung genügen, um den Tieren ihr Schicksal zu erleichtern. Sich am Boden suhlende Schweine, im Sand badendes Geflügel und Kühe, die ungestört ihrem Fortpflanzungstrieb nachgehen können, wünscht sich der Tierexperte: "Fast alle Nutztiere haben ähnliche Bedürfnisse, etwa genug Bewegung bei der Nahrungsaufnahme, ausreichende Körperpflege und die Möglichkeit, die Distanz zu den Artgenossen selbst zu bestimmen, um Konflikte zu vermeiden."
Was den Tieren gefällt, ist in der Tat kein Geheimnis mehr. Gerhard Schwarting von der Fachhochschule Nürtingen spricht zum Beispiel von "Schweinekomfort" und fordert von den Bauern mehr "liebevolle Ansprache" für das Borstenvieh.
Schwarting ist kein Schwärmer. Er hat das "Nürtinger System" erfunden: ein revolutionär anmutendes Haltungsverfahren für Schweine. Es entspringt der Einsicht, dass
selbst in jedem Industrieschwein noch eine Wildsau steckt, die ein intaktes Sozialgefüge und genug Beschäftigung und Auslauf braucht.
Herzstück der Anlage sind so genannte Ruhekissen, in die sich die frei umherlaufenden Schweine Backe an Backe zum Dösen und Schlafen zurückziehen können. Weil sich keine Sau gern im eigenen Dreck suhlt (Schwarting: "Das Schwein ist genau so reinlich wie der Mensch"), gibt es vom Wohnbereich getrennte Kotplätze. Die Borstenviecher können sich nach Belieben am Futterautomaten bedienen, sich in Wühlboxen vergnügen und zum Abkühlen danach die integrierte Duschanlage benutzen. Sogar ein Schweine-Karussell erprobt Schwarting derzeit, um die Tiere bei Laune zu halten.
In einem solchen Fünf-Sterne-Stall fühlt sich das Borstenvieh sauwohl. Das "Nürtinger System" beweist, dass artgerechte Nutztierhaltung nicht immer teurer sein muss als konventionelle Haltung: Auf etwa 1000 Mastschweine ist Schwartings Schweineanstalt ausgelegt. Das Fleisch, sagt der Agrarexperte, lasse sich mit dem System zum selben Preis wie mit herkömmlichen Haltungsverfahren produzieren.
Ohnehin sprechen auch wirtschaftliche Gründe für eine artgerechtere Haltung. Milchleistung und Fleischqualität der Tiere hängen maßgeblich von deren Wohlbefinden ab.
Nicoline Geverink, Agrarforscherin an der landwirtschaftlichen Universität im niederländischen Wageningen, empfiehlt Trainingsfahrten im Viehtransporter als Vorbereitung für den Gang zur Schlachtbank - durch die Gewöhnung könnte verhindert werden, dass der Transportstress die Schlachttiere tötet und sie damit nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet sind.
Auf dem landwirtschaftlichen Versuchsgut Hülsenberg im holsteinischen Wahlstedt führen Rindviecher im Dienste der Wissenschaft sogar fast schon ein luxuriöses Lotterleben. Vollautomatische Kraulmaschinen im Design von Autowaschanlagen sorgen dort für die wohlige Ganzkörpermassage nach dem Melken. Der Hit im Kuhstall sind mit 50 Liter Wasser gefüllte Gummimatratzen, die sich auf Kuhtemperatur vorwärmen lassen.
Hat das Rind die Wahl, zieht es das Wasserbett dem herkömmlichen Strohlager offenbar vor. Der Vorteil für den Bauern: Kühe, die besser ruhen und schlafen, sind entspannter und produzieren mehr Milch.
Auch so manches skurrile Detail kommt zu Tage, wenn Agrarexperten erst einmal anfangen, die Seelenlage des lieben Viehs zu ergründen. Vor zwei Jahren untersuchte die "Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen" 180 Kühe auf ihre Musikvorlieben. Jeweils einen Tag lang wurden die Tiere mit vier verschiedenen Liedern beschallt. Dann verglichen die Forscher die Milchleistung während der Musiktage mit einem stillen Kontrolltag.
Das Ergebnis zeigt, dass auch Kühe offenbar Musikgeschmack haben. Bei Mozarts "Eine kleine Nachtmusik" etwa gaben die Tiere 0,6 Prozent mehr Milch. Auch Guildo Horn regte die Drüsen an.
Nicht so gut kamen die Toten Hosen bei den Rindviechern an. Mit Abstand am schlechtesten aber schnitt die Volksmusik ab. Ausgerechnet "Herzilein" von den Wildecker Herzbuben verursachte den Kühen übles Euterdrücken: Die Milchleistung sank um 2,5 Prozent. PHILIP BETHGE,
JÖRG BLECH,
MANFRED DWORSCHAK, OLAF STAMPF, GÜNTHER STOCKINGER, KATJA THIMM
* Mit Biologiestudentin Juliane Bräuer am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. * Marc Bekoff (Hrsg.): "The smile of a dolphin. Remarkable accounts of animal emotions". Discovery Books; 224 Seiten; 35 Dollar. * Schauspielerin Glenn Close in "102 Dalmatiner". ** Marc Hauser: "Wild minds. What animals really think". Penguin Books; 404 Seiten; 19,80 Mark. * In den walisischen Bergen.
DER SPIEGEL 13/2001
Quelle: Spiegel




 von
von